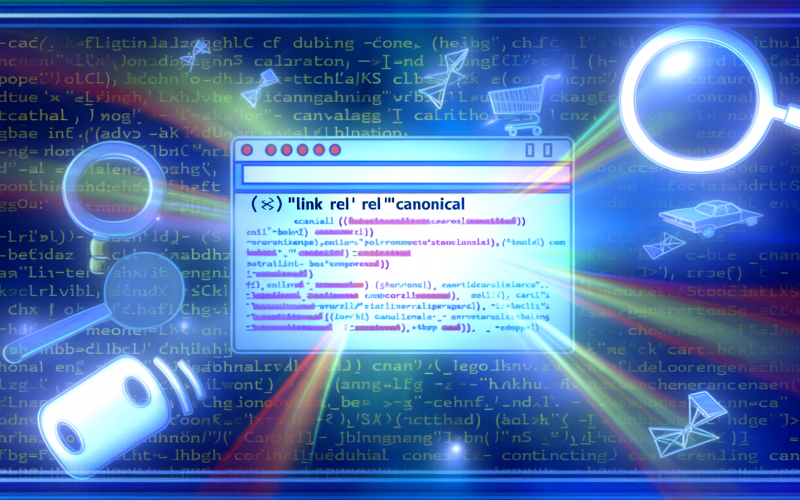Canonical Tag: Die Geheimwaffe gegen Duplicate Content und SEO-Kannibalismus
Der Canonical Tag ist ein unscheinbares, aber extrem mächtiges HTML-Element, das Website-Betreibern ermöglicht, SuchmaschinenSuchmaschinen: Das Rückgrat des Internets – Definition, Funktionsweise und Bedeutung Suchmaschinen sind die unsichtbaren Dirigenten des digitalen Zeitalters. Sie filtern, sortieren und präsentieren Milliarden von Informationen tagtäglich – und entscheiden damit, was im Internet gesehen wird und was gnadenlos im Daten-Nirwana verschwindet. Von Google bis Bing, von DuckDuckGo bis Yandex – Suchmaschinen sind weit mehr als simple Datenbanken. Sie sind... wie Google mitzuteilen, welche Version einer Seite als die „Original-Version“ (Kanonische URLURL: Mehr als nur eine Webadresse – Das Rückgrat des Internets entschlüsselt Die URL – Uniform Resource Locator – ist viel mehr als eine unscheinbare Zeile im Browser. Sie ist das Adresssystem des Internets, der unverzichtbare Wegweiser, der dafür sorgt, dass du und jeder Bot exakt dort landet, wo er hinwill. Ohne URLs gäbe es kein World Wide Web, keine...) gelten soll. Klingt banal? Ist es nicht. Ohne den Canonical Tag drohen Duplicate ContentDuplicate Content: Das SEO-Killer-Syndrom im Online-Marketing Duplicate Content, zu Deutsch „doppelter Inhalt“, ist einer der am meisten unterschätzten, aber folgenschwersten Fehler im SEO-Kosmos. Damit bezeichnet man identische oder sehr ähnliche Inhalte, die unter mehreren URLs im Internet auffindbar sind – entweder auf derselben Website (interner Duplicate Content) oder auf verschiedenen Domains (externer Duplicate Content). Google und andere Suchmaschinen mögen keine..., Rankingverluste und chaotische IndexierungIndexierung: Wie Webseiten den Weg in die Suchmaschine finden (und warum sie dort bleiben wollen) Autor: Tobias Hager Was bedeutet Indexierung? Definition, Grundlagen und der technische Prozess Indexierung ist im SEO-Kosmos das Eintrittsticket ins Spiel. Ohne Indexierung kein Ranking, keine Sichtbarkeit, kein Traffic – schlicht: keine Relevanz. Kurz gesagt bezeichnet Indexierung den Prozess, durch den Suchmaschinen wie Google, Bing oder.... Dieser Glossar-Artikel erklärt dir umfassend, was der Canonical Tag ist, wie er funktioniert, welche Fehler du besser nicht machst – und warum er für jede ernst gemeinte SEO-Strategie alternativlos ist.
Autor: Tobias Hager
Canonical Tag: Definition, Funktionsweise und technischer Hintergrund
Der Canonical Tag – korrekt bezeichnet als <link rel="canonical"> – ist ein HTML-Link-Element, das im <head>-Bereich einer Webseite platziert wird. Seine Aufgabe: SuchmaschinenSuchmaschinen: Das Rückgrat des Internets – Definition, Funktionsweise und Bedeutung Suchmaschinen sind die unsichtbaren Dirigenten des digitalen Zeitalters. Sie filtern, sortieren und präsentieren Milliarden von Informationen tagtäglich – und entscheiden damit, was im Internet gesehen wird und was gnadenlos im Daten-Nirwana verschwindet. Von Google bis Bing, von DuckDuckGo bis Yandex – Suchmaschinen sind weit mehr als simple Datenbanken. Sie sind... die „kanonische“ (bevorzugte) URLURL: Mehr als nur eine Webadresse – Das Rückgrat des Internets entschlüsselt Die URL – Uniform Resource Locator – ist viel mehr als eine unscheinbare Zeile im Browser. Sie ist das Adresssystem des Internets, der unverzichtbare Wegweiser, der dafür sorgt, dass du und jeder Bot exakt dort landet, wo er hinwill. Ohne URLs gäbe es kein World Wide Web, keine... einer Seite zu signalisieren. Das ist vor allem dann entscheidend, wenn identische oder sehr ähnliche Inhalte unter verschiedenen URLs erreichbar sind. Duplicate ContentDuplicate Content: Das SEO-Killer-Syndrom im Online-Marketing Duplicate Content, zu Deutsch „doppelter Inhalt“, ist einer der am meisten unterschätzten, aber folgenschwersten Fehler im SEO-Kosmos. Damit bezeichnet man identische oder sehr ähnliche Inhalte, die unter mehreren URLs im Internet auffindbar sind – entweder auf derselben Website (interner Duplicate Content) oder auf verschiedenen Domains (externer Duplicate Content). Google und andere Suchmaschinen mögen keine... lässt grüßen: Parameter-URLs, Filterseiten, Paginierungen, Session-IDs oder simple Druckversionen sind die Klassiker.
Technisch sieht der Canonical Tag so aus:
<link rel="canonical" href="https://www.beispiel.de/wichtige-seite/" />
Der Wert des href-Attributs gibt die bevorzugte URLURL: Mehr als nur eine Webadresse – Das Rückgrat des Internets entschlüsselt Die URL – Uniform Resource Locator – ist viel mehr als eine unscheinbare Zeile im Browser. Sie ist das Adresssystem des Internets, der unverzichtbare Wegweiser, der dafür sorgt, dass du und jeder Bot exakt dort landet, wo er hinwill. Ohne URLs gäbe es kein World Wide Web, keine... an. Google und andere SuchmaschinenSuchmaschinen: Das Rückgrat des Internets – Definition, Funktionsweise und Bedeutung Suchmaschinen sind die unsichtbaren Dirigenten des digitalen Zeitalters. Sie filtern, sortieren und präsentieren Milliarden von Informationen tagtäglich – und entscheiden damit, was im Internet gesehen wird und was gnadenlos im Daten-Nirwana verschwindet. Von Google bis Bing, von DuckDuckGo bis Yandex – Suchmaschinen sind weit mehr als simple Datenbanken. Sie sind... werten dieses Signal aus und indexieren (idealerweise) nur die als „kanonisch“ markierte Version. So wird verhindert, dass die Rankingkraft (Link JuiceLink Juice: Die unsichtbare Währung des SEO Link Juice beschreibt die Übertragung von „Rankingkraft“ oder „SEO-Power“ durch Hyperlinks von einer Webseite auf eine andere. In der Welt der Suchmaschinenoptimierung ist Link Juice das, was zwischen Backlinks, interner Verlinkung und Sichtbarkeit im Netz vermittelt wird – und damit so etwas wie die geheime Ressource im Kampf um die besten Google-Plätze. Wer...) auf mehrere identische Seiten verteilt wird oder – noch schlimmer – die Seite wegen Duplicate ContentDuplicate Content: Das SEO-Killer-Syndrom im Online-Marketing Duplicate Content, zu Deutsch „doppelter Inhalt“, ist einer der am meisten unterschätzten, aber folgenschwersten Fehler im SEO-Kosmos. Damit bezeichnet man identische oder sehr ähnliche Inhalte, die unter mehreren URLs im Internet auffindbar sind – entweder auf derselben Website (interner Duplicate Content) oder auf verschiedenen Domains (externer Duplicate Content). Google und andere Suchmaschinen mögen keine... abgestraft wird.
Wichtig: Der Canonical Tag ist eine Empfehlung, kein Befehl. SuchmaschinenSuchmaschinen: Das Rückgrat des Internets – Definition, Funktionsweise und Bedeutung Suchmaschinen sind die unsichtbaren Dirigenten des digitalen Zeitalters. Sie filtern, sortieren und präsentieren Milliarden von Informationen tagtäglich – und entscheiden damit, was im Internet gesehen wird und was gnadenlos im Daten-Nirwana verschwindet. Von Google bis Bing, von DuckDuckGo bis Yandex – Suchmaschinen sind weit mehr als simple Datenbanken. Sie sind... können sich aus guten Gründen auch gegen den Canonical Tag entscheiden, etwa bei widersprüchlichen Signalen (z. B. fehlerhaftes Canonical, interne VerlinkungInterne Verlinkung: Das unterschätzte Rückgrat jeder erfolgreichen Website Interne Verlinkung ist der technische und strategische Prozess, bei dem einzelne Seiten einer Website durch Hyperlinks miteinander verbunden werden. Was für viele wie banale Blaupausen im Content Management System wirkt, ist in Wahrheit einer der mächtigsten Hebel für SEO, Nutzerführung und nachhaltiges Wachstum. Ohne eine durchdachte interne Linkstruktur bleibt selbst der beste... auf andere URLs, hreflang-Chaos).
Warum der Canonical Tag für SEO unverzichtbar ist
Duplicate ContentDuplicate Content: Das SEO-Killer-Syndrom im Online-Marketing Duplicate Content, zu Deutsch „doppelter Inhalt“, ist einer der am meisten unterschätzten, aber folgenschwersten Fehler im SEO-Kosmos. Damit bezeichnet man identische oder sehr ähnliche Inhalte, die unter mehreren URLs im Internet auffindbar sind – entweder auf derselben Website (interner Duplicate Content) oder auf verschiedenen Domains (externer Duplicate Content). Google und andere Suchmaschinen mögen keine... ist eines der unterschätzten SEO-Killerkriterien. Warum? Weil SuchmaschinenSuchmaschinen: Das Rückgrat des Internets – Definition, Funktionsweise und Bedeutung Suchmaschinen sind die unsichtbaren Dirigenten des digitalen Zeitalters. Sie filtern, sortieren und präsentieren Milliarden von Informationen tagtäglich – und entscheiden damit, was im Internet gesehen wird und was gnadenlos im Daten-Nirwana verschwindet. Von Google bis Bing, von DuckDuckGo bis Yandex – Suchmaschinen sind weit mehr als simple Datenbanken. Sie sind... Schwierigkeiten haben, zu entscheiden, welche von mehreren ähnlichen Seiten im Index und damit im RankingRanking: Das kompromisslose Spiel um die Sichtbarkeit in Suchmaschinen Ranking bezeichnet im Online-Marketing die Platzierung einer Website oder einzelner URLs in den organischen Suchergebnissen einer Suchmaschine, typischerweise Google. Es ist der digitale Olymp, auf den jeder Website-Betreiber schielt – denn nur wer bei relevanten Suchanfragen weit oben rankt, existiert überhaupt im Kopf der Zielgruppe. Ranking ist keine Glückssache, sondern das... landen soll. Die Folge: Rankingverluste, Streuverluste bei BacklinksBacklinks: Der heilige Gral der Offpage-SEO – Macht, Manipulation und Mythen Backlinks sind das Rückgrat der Offpage-Suchmaschinenoptimierung – und für viele das Synonym für Autorität im Netz. Ein Backlink ist nichts anderes als ein eingehender Link von einer externen Website auf die eigene Seite. Klingt simpel? Ist es nicht. Im Kosmos der SEO sind Backlinks Vertrauensbeweis, Rankingfaktor, Manipulationsobjekt und bis..., Crawling-Budget-Verschwendung. Der Canonical Tag räumt auf: Er weist die Suchmaschine klar an, welche Seite als einzige maßgeblich ist.
Typische Szenarien, in denen der Canonical Tag Pflicht ist:
- Filter-/Sortieroptionen: Shops, die Produkte nach Farben, Größen, Preisen filtern, generieren zig Parameter-URLs. Die Inhalte bleiben weitgehend identisch.
- Paginierung: Listen- oder Kategorieseiten, die über „?page=2“, „?page=3“ etc. erreichbar sind.
- Druckversionen: Viele CMSCMS (Content Management System): Das Betriebssystem für das Web CMS steht für Content Management System und ist das digitale Rückgrat moderner Websites, Blogs, Shops und Portale. Ein CMS ist eine Software, die es ermöglicht, Inhalte wie Texte, Bilder, Videos und Strukturelemente ohne Programmierkenntnisse zu erstellen, zu verwalten und zu veröffentlichen. Ob WordPress, TYPO3, Drupal oder ein Headless CMS – das... erzeugen für Print eine eigene URLURL: Mehr als nur eine Webadresse – Das Rückgrat des Internets entschlüsselt Die URL – Uniform Resource Locator – ist viel mehr als eine unscheinbare Zeile im Browser. Sie ist das Adresssystem des Internets, der unverzichtbare Wegweiser, der dafür sorgt, dass du und jeder Bot exakt dort landet, wo er hinwill. Ohne URLs gäbe es kein World Wide Web, keine... („/drucken/“), die aber 1:1 den Originalinhalt enthält.
- Session-IDs und Tracking-Parameter: Besonders unschön, da sie oft automatisiert generiert werden und so massenhaft „Zwillingsseiten“ entstehen.
- ContentContent: Das Herzstück jedes Online-Marketings Content ist der zentrale Begriff jeder digitalen Marketingstrategie – und das aus gutem Grund. Ob Text, Bild, Video, Audio oder interaktive Elemente: Unter Content versteht man sämtliche Inhalte, die online publiziert werden, um eine Zielgruppe zu informieren, zu unterhalten, zu überzeugen oder zu binden. Content ist weit mehr als bloßer Füllstoff zwischen Werbebannern; er ist... Syndication: Wenn Inhalte auf mehreren Domains oder Partnerseiten erscheinen, kann der Canonical Tag auf die Ursprungsquelle gesetzt werden.
Wer den Canonical Tag clever einsetzt, stärkt seine „Money Pages“, bündelt Autorität und vermeidet, dass Google die falsche Seite bevorzugt. Im härter werdenden SEO-Wettbewerb kann das den Unterschied zwischen Seite 1 und Seite Nirwana bedeuten.
Canonical Tag richtig implementieren: Best Practices und häufige Fehler
Der Canonical Tag ist kein Hexenwerk – aber wehe, er wird falsch eingesetzt. Fehler bei der Implementierung führen schnell zu Indexierungsdesastern, Rankingverlusten oder komplettem Sichtbarkeits-GAU. Deshalb hier die wichtigsten Best Practices und Stolperfallen:
- Absolute URLs verwenden: Immer die vollständige URLURL: Mehr als nur eine Webadresse – Das Rückgrat des Internets entschlüsselt Die URL – Uniform Resource Locator – ist viel mehr als eine unscheinbare Zeile im Browser. Sie ist das Adresssystem des Internets, der unverzichtbare Wegweiser, der dafür sorgt, dass du und jeder Bot exakt dort landet, wo er hinwill. Ohne URLs gäbe es kein World Wide Web, keine... inkl. Protokoll angeben („httpsHTTPS: Das Rückgrat der sicheren Datenübertragung im Web HTTPS steht für „Hypertext Transfer Protocol Secure“ und ist der Standard für die verschlüsselte Übertragung von Daten zwischen Browser und Webserver. Anders als das unsichere HTTP bietet HTTPS einen kryptografisch abgesicherten Kommunikationskanal. Ohne HTTPS bist du im Internet nackt – und das nicht mal im positiven Sinne. In Zeiten von Cybercrime, Datenschutz-Grundverordnung...://…“). Relative Pfade sind riskant, da SuchmaschinenSuchmaschinen: Das Rückgrat des Internets – Definition, Funktionsweise und Bedeutung Suchmaschinen sind die unsichtbaren Dirigenten des digitalen Zeitalters. Sie filtern, sortieren und präsentieren Milliarden von Informationen tagtäglich – und entscheiden damit, was im Internet gesehen wird und was gnadenlos im Daten-Nirwana verschwindet. Von Google bis Bing, von DuckDuckGo bis Yandex – Suchmaschinen sind weit mehr als simple Datenbanken. Sie sind... sie unterschiedlich interpretieren können.
- Self-Referencing Canonical: Jede Seite sollte im Normalfall einen Canonical Tag auf sich selbst setzen. Das schafft Klarheit und verhindert Missverständnisse.
- Keine widersprüchlichen Signale: Canonical Tag, interne Links und hreflang-Attribute müssen auf die gleiche URLURL: Mehr als nur eine Webadresse – Das Rückgrat des Internets entschlüsselt Die URL – Uniform Resource Locator – ist viel mehr als eine unscheinbare Zeile im Browser. Sie ist das Adresssystem des Internets, der unverzichtbare Wegweiser, der dafür sorgt, dass du und jeder Bot exakt dort landet, wo er hinwill. Ohne URLs gäbe es kein World Wide Web, keine... zeigen. Widersprüche führen dazu, dass Google das Signal ignoriert.
- Nur eine kanonische Seite pro „Cluster“: Niemals mehrere Seiten auf sich gegenseitig als „canonical“ referenzieren („Kanonisches Pingpong“). Immer eine Seite als Master definieren.
- Kein Canonical auf paginierte Seiten: Bei Paginierung (z. B. Blog-Seite 1, 2, 3…) ist die beste Praxis, jede Seite auf sich selbst zu kanonisieren und
rel="next"/rel="prev"zu verwenden (auch wenn Google diese Signale offiziell eingestellt hat, helfen sie anderen SuchmaschinenSuchmaschinen: Das Rückgrat des Internets – Definition, Funktionsweise und Bedeutung Suchmaschinen sind die unsichtbaren Dirigenten des digitalen Zeitalters. Sie filtern, sortieren und präsentieren Milliarden von Informationen tagtäglich – und entscheiden damit, was im Internet gesehen wird und was gnadenlos im Daten-Nirwana verschwindet. Von Google bis Bing, von DuckDuckGo bis Yandex – Suchmaschinen sind weit mehr als simple Datenbanken. Sie sind... und Crawlern). - Vorsicht bei Noindex: Eine Seite, die „noindex“ im Meta-Tag trägt, sollte keinen Canonical-Tag auf eine indexierbare Seite enthalten – das führt zu widersprüchlichen Anweisungen.
Und der Klassiker: Niemals Canonical Tags mit Weiterleitungen verwechseln! Ein Canonical signalisiert lediglich eine Präferenz, während eine 301-Weiterleitung den Nutzer und CrawlerCrawler: Die unsichtbaren Arbeiter der digitalen Welt Crawler – auch bekannt als Spider, Bot oder Robot – sind automatisierte Programme, die das Fundament des modernen Internets bilden. Sie durchforsten systematisch Webseiten, erfassen Inhalte, analysieren Strukturen und übermitteln diese Daten an Suchmaschinen, Plattformen oder andere zentrale Dienste. Ohne Crawler wäre Google blind, SEO irrelevant und das World Wide Web ein chaotischer... technisch zwingt, auf die Zielseite zu wechseln.
Canonical Tag in der Praxis: Tools, Kontrolle und Troubleshooting
Die Implementierung eines Canonical Tags ist das eine – die Kontrolle das andere. Viele Websites unterschätzen, wie schnell sich durch CMS-Updates, Plugins oder fehlerhafte Scripte fehlerhafte Canonicals einschleichen. Deshalb: Monitoring und regelmäßige Audits sind Pflicht.
Empfohlene Tools und Methoden:
- Google Search ConsoleGoogle Search Console: Dein Kontrollzentrum für SEO und Website-Performance Die Google Search Console (GSC) ist das offizielle, kostenlose Analyse- und Überwachungstool von Google für Website-Betreiber, SEOs und Online-Marketing-Profis. Sie liefert unverzichtbare Einblicke in Sichtbarkeit, technische Performance, Indexierung und Suchmaschinen-Rankings. Wer seine Website ernsthaft betreibt, kommt an der Google Search Console nicht vorbei – denn ohne Daten bist du im SEO...: Zeigt an, welche Seiten als „canonical“ erkannt wurden – und ob Google deiner Empfehlung überhaupt folgt.
- Crawling-Tools: Screaming Frog, Sitebulb oder Ryte crawlen die komplette Website und listen Canonical-Fehler (z. B. Ketten, Loops, fehlende Tags) auf.
- Manuelle Kontrolle: Im Quelltext prüfen, ob der Tag korrekt gesetzt ist, keine Tippfehler enthält und die gewünschte URLURL: Mehr als nur eine Webadresse – Das Rückgrat des Internets entschlüsselt Die URL – Uniform Resource Locator – ist viel mehr als eine unscheinbare Zeile im Browser. Sie ist das Adresssystem des Internets, der unverzichtbare Wegweiser, der dafür sorgt, dass du und jeder Bot exakt dort landet, wo er hinwill. Ohne URLs gäbe es kein World Wide Web, keine... angegeben ist.
Typische Troubleshooting-Szenarien:
- Google ignoriert Canonical: Möglicherweise gibt es widersprüchliche interne Links oder hreflang-Tags. Oder die Seite ist per Robots.txtRobots.txt: Das Bollwerk zwischen Crawlern und deinen Daten Die robots.txt ist das vielleicht meistunterschätzte, aber mächtigste Textfile im Arsenal eines jeden Website-Betreibers – und der Gatekeeper beim Thema Crawling. Sie entscheidet, welche Bereiche deiner Website von Suchmaschinen-Crawlern betreten werden dürfen und welche nicht. Ohne robots.txt bist du digital nackt – und der Googlebot tanzt, wo er will. In diesem Artikel... gesperrt.
- Canonical Loops: Wenn Seite A auf Seite B, und Seite B auf Seite A als canonical verweist. Ergebnis: Google ignoriert beide.
- Fehlende Canonicals auf wichtigen Seiten: Besonders bei CMS-generierten Seiten, Kategorie- oder Produktvarianten.
Canonical Tag, hreflang und internationale SEO: Das Power-Trio für globale Projekte
Wer international agiert, kommt um die Kombination von Canonical Tag und hreflang nicht herum. hreflang signalisiert SuchmaschinenSuchmaschinen: Das Rückgrat des Internets – Definition, Funktionsweise und Bedeutung Suchmaschinen sind die unsichtbaren Dirigenten des digitalen Zeitalters. Sie filtern, sortieren und präsentieren Milliarden von Informationen tagtäglich – und entscheiden damit, was im Internet gesehen wird und was gnadenlos im Daten-Nirwana verschwindet. Von Google bis Bing, von DuckDuckGo bis Yandex – Suchmaschinen sind weit mehr als simple Datenbanken. Sie sind..., welche Sprach- und Länderversionen einer Seite existieren. Der Canonical Tag sorgt dafür, dass pro Sprachversion die jeweils „echte“ Originalseite indexiert wird – ohne Duplicate ContentDuplicate Content: Das SEO-Killer-Syndrom im Online-Marketing Duplicate Content, zu Deutsch „doppelter Inhalt“, ist einer der am meisten unterschätzten, aber folgenschwersten Fehler im SEO-Kosmos. Damit bezeichnet man identische oder sehr ähnliche Inhalte, die unter mehreren URLs im Internet auffindbar sind – entweder auf derselben Website (interner Duplicate Content) oder auf verschiedenen Domains (externer Duplicate Content). Google und andere Suchmaschinen mögen keine... zwischen Sprachvarianten zu riskieren.
Best Practices für die Kombination:
- Jede Sprach- oder Länderversion erhält einen Canonical Tag auf die eigene URLURL: Mehr als nur eine Webadresse – Das Rückgrat des Internets entschlüsselt Die URL – Uniform Resource Locator – ist viel mehr als eine unscheinbare Zeile im Browser. Sie ist das Adresssystem des Internets, der unverzichtbare Wegweiser, der dafür sorgt, dass du und jeder Bot exakt dort landet, wo er hinwill. Ohne URLs gäbe es kein World Wide Web, keine....
- Alle Versionen verweisen per hreflang-Tag aufeinander.
- Keine Canonical-Verlinkung auf eine andere Sprachversion, da sonst alle internationalen Seiten aus dem Index fliegen könnten.
Wer hier schlampt, riskiert, dass Google die falsche Länderseite als „Master“ auswählt – und die eigentliche ZielgruppeZielgruppe: Das Rückgrat jeder erfolgreichen Marketingstrategie Die Zielgruppe ist das A und O jeder Marketing- und Kommunikationsstrategie. Vergiss fancy Tools, bunte Banner oder die neueste AI-Content-Spielerei – wenn du nicht weißt, wen du eigentlich erreichen willst, kannst du dir den Rest sparen. Unter Zielgruppe versteht man die definierte Menge an Personen, für die ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine Botschaft... auf der Strecke bleibt. Für Enterprise-SEOs ist das Thema Canonical/hreflang keine Kür, sondern Pflichtlektüre.
Fazit: Canonical Tag – kleines HTML-Tag, maximaler SEO-Impact
Der Canonical Tag ist die unsichtbare Macht im SEO-Toolkit: Er verhindert Duplicate ContentDuplicate Content: Das SEO-Killer-Syndrom im Online-Marketing Duplicate Content, zu Deutsch „doppelter Inhalt“, ist einer der am meisten unterschätzten, aber folgenschwersten Fehler im SEO-Kosmos. Damit bezeichnet man identische oder sehr ähnliche Inhalte, die unter mehreren URLs im Internet auffindbar sind – entweder auf derselben Website (interner Duplicate Content) oder auf verschiedenen Domains (externer Duplicate Content). Google und andere Suchmaschinen mögen keine..., bündelt Linkkraft, sorgt für eine saubere IndexierungIndexierung: Wie Webseiten den Weg in die Suchmaschine finden (und warum sie dort bleiben wollen) Autor: Tobias Hager Was bedeutet Indexierung? Definition, Grundlagen und der technische Prozess Indexierung ist im SEO-Kosmos das Eintrittsticket ins Spiel. Ohne Indexierung kein Ranking, keine Sichtbarkeit, kein Traffic – schlicht: keine Relevanz. Kurz gesagt bezeichnet Indexierung den Prozess, durch den Suchmaschinen wie Google, Bing oder... und schützt vor Rankingverlusten. Wer den Canonical Tag ignoriert oder schlampig implementiert, verliert im härtesten Wettbewerb der digitalen Welt. Denn Google ist nicht dein Freund – aber der Canonical Tag kann dein bester Verbündeter sein. Also: Setz ihn klug ein, prüfe seine Wirkung regelmäßig und zeig Duplicate ContentDuplicate Content: Das SEO-Killer-Syndrom im Online-Marketing Duplicate Content, zu Deutsch „doppelter Inhalt“, ist einer der am meisten unterschätzten, aber folgenschwersten Fehler im SEO-Kosmos. Damit bezeichnet man identische oder sehr ähnliche Inhalte, die unter mehreren URLs im Internet auffindbar sind – entweder auf derselben Website (interner Duplicate Content) oder auf verschiedenen Domains (externer Duplicate Content). Google und andere Suchmaschinen mögen keine... die rote Karte. Wer SEOSEO (Search Engine Optimization): Das Schlachtfeld der digitalen Sichtbarkeit SEO, kurz für Search Engine Optimization oder Suchmaschinenoptimierung, ist der Schlüsselbegriff für alle, die online überhaupt gefunden werden wollen. Es bezeichnet sämtliche Maßnahmen, mit denen Websites und deren Inhalte so optimiert werden, dass sie in den unbezahlten, organischen Suchergebnissen von Google, Bing und Co. möglichst weit oben erscheinen. SEO ist längst... ernst meint, nimmt den Canonical Tag so ernst wie die eigene Domain.